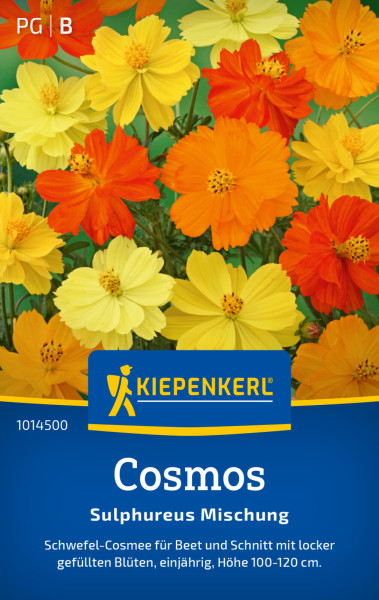Die Kornrade: Ein Überbleibsel vergangener Zeiten
Die Kornrade, einst ein alltäglicher Anblick auf deutschen Feldern, ist heute eine Rarität geworden. Doch ihre Geschichte und Bedeutung sind alles andere als gewöhnlich.
Wissenswertes zur Kornrade auf einen Blick
- Wissenschaftlicher Name: Agrostemma githago
- Gehört zur Familie der Nelkengewächse
- Einjährige Pflanze mit auffälligen rosa-violetten Blüten
- Vom Aussterben bedroht in Deutschland
- Wichtig für die Artenvielfalt und Insekten
Was ist die Kornrade (Agrostemma githago)?
Die Kornrade ist eine Pflanze, die mich seit Jahren interessiert. Als Biologin habe ich sie oft beobachtet und studiert. Diese einjährige Pflanze gehört zur Familie der Nelkengewächse und hat einen ganz besonderen Charme. Mit ihren auffälligen rosa-violetten Blüten ist sie ein echter Hingucker zwischen den Getreidehalmen.
Interessant ist, dass die Kornrade eine sogenannte Kulturfolger-Pflanze ist. Das bedeutet, sie hat sich perfekt an den Ackerbau angepasst. Ihr Lebenszyklus ist genau auf den Rhythmus des Getreideanbaus abgestimmt. Die Samen keimen im Herbst, überdauern als kleine Pflänzchen den Winter und wachsen im Frühjahr mit dem Getreide um die Wette.
Historische Bedeutung in der Landwirtschaft
Früher war die Kornrade auf jedem Getreidefeld zu finden. Ich erinnere mich noch gut an die Erzählungen meiner Großmutter, die von Feldern voller Kornraden schwärmte. Sie war so häufig, dass ihr Name sogar sprichwörtlich wurde: "Unkraut wie die Raden" sagte man.
Allerdings hatte die Kornrade auch ihre Schattenseiten. Ihre Samen sind giftig und gelangten oft ins Mehl. Das führte zu gesundheitlichen Problemen, wenn das Brot mit diesem Mehl gebacken wurde. Deshalb galt die Kornrade lange Zeit als lästiges Unkraut, das es zu bekämpfen galt.
Mit der Intensivierung der Landwirtschaft und verbesserten Reinigungsmethoden für das Saatgut begann der Niedergang der Kornrade. Die einst so häufige Pflanze wurde immer seltener.
Aktueller Gefährdungsstatus
Heute steht die Kornrade auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. In vielen Regionen Deutschlands gilt sie sogar als vom Aussterben bedroht. Das finde ich persönlich sehr bedauerlich, denn mit der Kornrade verschwindet nicht nur eine schöne Blume, sondern auch ein Stück Kulturgeschichte.
Glücklicherweise gibt es mittlerweile Bemühungen, die Kornrade zu erhalten. In Naturschutzgebieten und auf speziellen Ackerrandstreifen wird sie wieder angesiedelt. Auch in meinem eigenen Garten habe ich einen kleinen Bereich, in dem ich Kornraden aussäe - natürlich weit weg von meinen Gemüsebeeten, um eine Vermischung zu vermeiden.
Botanische Merkmale und Ökologie der Kornrade
Morphologie und Wachstumszyklus
Die Kornrade ist eine bemerkenswerte Pflanze, wenn man genau hinsieht. Sie wird etwa 50 bis 100 cm hoch und hat schmale, lanzettliche Blätter, die dicht behaart sind. Was mich immer wieder beeindruckt, ist ihre Anpassungsfähigkeit. Je nach Standort kann sie ganz unterschiedlich aussehen - mal üppig und verzweigt, mal schlank und aufrecht.
Die Blüten der Kornrade sind auffällig. Sie haben fünf rosa-violette Kronblätter mit dunklen Adern. Was viele nicht wissen: Die Blüten öffnen sich nur bei Sonnenschein. An trüben Tagen bleiben sie geschlossen - ein interessantes Beispiel dafür, wie Pflanzen auf ihre Umwelt reagieren.
Der Lebenszyklus der Kornrade ist perfekt an den Getreideanbau angepasst. Die Samen keimen im Herbst, kurz nachdem das Wintergetreide ausgesät wurde. Die jungen Pflanzen überwintern als kleine Rosetten und beginnen im Frühjahr kräftig zu wachsen. Zur Erntezeit sind die Samenkapseln reif und platzen auf, sodass die Samen mit dem Getreide geerntet werden können.
Standortansprüche und Verbreitung
Die Kornrade ist eine typische Pflanze der Getreidefelder. Sie bevorzugt kalkhaltige, lehmige Böden und kommt am besten auf Wintergetreidefeldern zurecht. In meiner Arbeit als Biologin habe ich beobachtet, dass sie besonders gut auf extensiv bewirtschafteten Äckern gedeiht.
Früher war die Kornrade in ganz Mitteleuropa verbreitet. Heute findet man sie nur noch selten in freier Natur. In Deutschland gibt es noch einige Vorkommen, vor allem in Schutzgebieten und auf speziell angelegten Ackerwildkrautstreifen. Ich habe sie zum Beispiel im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin gesehen - ein beeindruckendes Erlebnis!
Ökologische Nische im Agrarökosystem
Die Kornrade spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem des Ackers. Sie bietet Nahrung und Lebensraum für viele Insekten, besonders für Wildbienen und Schmetterlinge. Ich habe oft beobachtet, wie Hummeln regelrecht in den Blüten verschwinden, um an den Nektar zu kommen.
Aber die Kornrade ist nicht nur für Insekten wichtig. Ihre Samen sind eine beliebte Nahrung für Vögel, besonders für Feldvögel wie die Feldlerche. In Zeiten, in denen viele Feldvögel unter Nahrungsmangel leiden, kann die Kornrade einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität leisten.
Interessant finde ich auch, dass die Kornrade eine Art biologischer Indikator ist. Ihr Vorkommen zeigt an, dass ein Acker extensiv bewirtschaftet wird und wenig Herbizide zum Einsatz kommen. So kann sie uns helfen, die ökologische Qualität von Agrarflächen zu beurteilen.
Die Rolle der Kornrade in der Biodiversität
Bedeutung für Insekten, insbesondere Bienen und Schmetterlinge
Als Biologin beobachte ich immer wieder, wie wichtig einzelne Pflanzenarten für das gesamte Ökosystem sein können. Die Kornrade ist dafür ein gutes Beispiel. Ihre großen, auffälligen Blüten ziehen viele Insekten an. Besonders Wildbienen und Hummeln fliegen drauf.
Ich erinnere mich an einen Sommertag, an dem ich eine blühende Kornrade beobachtete. Es war ein ständiges Kommen und Gehen von verschiedenen Insektenarten. Besonders eine kleine Wildbiene hatte es mir angetan. Sie schien regelrecht in der Blüte zu verschwinden, um an den Nektar zu kommen.
Auch Schmetterlinge profitieren von der Kornrade. Arten wie der Kleine Fuchs oder das Tagpfauenauge nutzen sie gerne als Nektarquelle. In Zeiten, in denen viele Insektenarten unter Nahrungsmangel leiden, kann die Kornrade einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten.
Funktion als Nahrungsquelle und Habitat
Die Bedeutung der Kornrade geht über ihre Funktion als Nahrungsquelle hinaus. Sie bietet auch Lebensraum für verschiedene Insektenarten. Zwischen ihren Blättern und Stängeln finden kleine Käfer und Spinnen Unterschlupf. Sogar einige Wildbienenarten nutzen die hohlen Stängel abgestorbener Kornraden als Nistplatz.
Ein besonders interessantes Beispiel ist die Beziehung zwischen der Kornrade und bestimmten Samenkäfern. Diese spezialisierten Käfer legen ihre Eier in die unreifen Samenkapseln der Kornrade. Die Larven ernähren sich dann von den heranreifenden Samen. Es ist interessant zu sehen, wie eng verwoben die Lebenszyklen verschiedener Arten sein können.
Beitrag zur genetischen Vielfalt in Agrarlandschaften
Die Kornrade leistet einen wichtigen Beitrag zur genetischen Vielfalt in unseren Agrarlandschaften. Als angepasste Wildpflanze trägt sie Gene in sich, die möglicherweise in Zukunft von Bedeutung sein könnten. Zum Beispiel könnte ihre Fähigkeit, mit kargen Böden zurechtzukommen, für die Züchtung neuer, widerstandsfähiger Kulturpflanzen interessant sein.
Darüber hinaus ist die Kornrade Teil eines komplexen Ökosystems. Ihr Verschwinden könnte Auswirkungen haben, die wir noch gar nicht absehen können. Es ist wie bei einem Jenga-Turm: Zieht man einen Baustein heraus, kann das ganze System ins Wanken geraten.
In meiner Arbeit als Biologin habe ich gelernt, wie wichtig es ist, die Vielfalt in unseren Agrarökosystemen zu erhalten. Die Kornrade ist dabei mehr als nur eine hübsche Blume am Feldrand. Sie ist ein wichtiger Baustein in einem komplexen Netzwerk von Beziehungen zwischen Pflanzen, Tieren und ihrer Umwelt.
Gründe für den Rückgang der Kornrade: Ein Blick in die Vergangenheit
Die Kornrade, einst ein vertrauter Anblick in deutschen Getreidefeldern, ist heute eine Seltenheit geworden. Wie konnte es dazu kommen? Betrachten wir die Faktoren, die zum Niedergang dieser besonderen Pflanze geführt haben.
Die Intensivierung der Landwirtschaft: Veränderungen mit Folgen
Moderne landwirtschaftliche Methoden haben vieles verändert. Effizienzsteigerung stand im Vordergrund, doch für die Kornrade bedeutete dies den Anfang vom Ende. Größere Felder, weniger Randstreifen und der Einsatz von Maschinen haben ihren Lebensraum drastisch eingeschränkt. In meiner Kindheit waren die zarten lila Blüten überall zu sehen. Heute ist eine Kornrade ein seltener Anblick.
Herbizideinsatz und Saatgutreinigung: Unerwartete Auswirkungen
Der verstärkte Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln hat der Kornrade zugesetzt. Diese Pflanzen, früher natürlicher Teil des Getreides, wurden plötzlich als unerwünschte Konkurrenz betrachtet. Hinzu kommt die verbesserte Saatgutreinigung. Früher wurden die Samen der Kornrade unbeabsichtigt mit dem Getreide ausgesät. Heute werden sie sorgfältig aussortiert. Was einst selbstverständlich zur Ackerflora gehörte, wird nun entfernt.
Die Giftigkeit der Samen: Ein komplexer Aspekt
Ein weiterer Grund für den Rückgang der Kornrade liegt in ihren giftigen Samen. Diese enthalten Saponine, die bei Verzehr gesundheitsschädlich sein können. Früher war das kein großes Problem, da die Menge an Kornradensamen im Getreide gering war. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft wurde die Kornrade jedoch zunehmend als Gefahr wahrgenommen. Wie bei vielen Dingen in der Natur gilt: In Maßen kein Problem, im Übermaß potenziell gefährlich.
Kornraden und Artenschutz: Neue Perspektiven
Das Bewusstsein für die Bedeutung der Artenvielfalt ist in den letzten Jahren gewachsen. Die Kornrade gewinnt wieder an Aufmerksamkeit – diesmal als schützenswerter Teil unserer Natur.
Aktuelle Schutzmaßnahmen und Projekte: Positive Entwicklungen
Verschiedene Initiativen setzen sich für den Erhalt der Kornrade ein. Naturschutzverbände, botanische Gärten und einige aufgeschlossene Landwirte beteiligen sich an Projekten zur Wiederansiedlung. In meiner Heimatregion gibt es ein interessantes Projekt, bei dem alte Getreidesorten zusammen mit typischen Ackerwildkräutern angebaut werden. Es ist erfreulich zu sehen, wie die Felder wieder bunter werden.
Wiederansiedlung in Blühstreifen und Naturschutzgebieten: Neue Lebensräume
Blühstreifen am Feldrand bieten nicht nur der Kornrade, sondern auch vielen Insekten einen Lebensraum. In Naturschutzgebieten werden gezielt Flächen für die Ansiedlung von Ackerwildkräutern geschaffen. Die Entwicklung dieser Flächen zu beobachten, ist sehr interessant. Sie zeigen uns, wie unsere Felder früher einmal ausgesehen haben.
Integration in Agrarumweltprogramme: Vorteile für Natur und Landwirtschaft
Bemerkenswert sind die Bemühungen, den Schutz der Kornrade in Agrarumweltprogramme zu integrieren. Landwirte können finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie Flächen für Ackerwildkräuter bereitstellen. Dieser Ansatz verbindet Naturschutz mit landwirtschaftlichen Interessen. Ein Bauer aus meinem Bekanntenkreis, anfangs skeptisch, berichtet nun begeistert von der Vielfalt auf seinen Feldern.
Anbau und Pflege von Kornraden: Naturschutz im Kleinen
Wer die Kornrade unterstützen möchte, kann das auch im kleinen Rahmen tun. In meinem Garten habe ich einen Bereich für Wildpflanzen eingerichtet, wo sich die Kornrade wohlfühlt.
Geeignete Standorte und Bodenbedingungen: Anpassungsfähig und genügsam
Kornraden sind recht genügsam. Sie bevorzugen sonnige bis halbschattige Standorte und kommen mit den meisten Bodenarten zurecht. Allerdings mögen sie es nicht zu feucht. In meinem Garten wachsen sie am besten an einer leicht erhöhten Stelle, wo das Wasser gut abfließen kann. Ein leichter, sandiger Lehmboden scheint ihnen besonders zu behagen.
Aussaat und Kultivierungstechniken: Einfache Methoden
Die Aussaat ist unkompliziert. Am besten sät man die Kornraden im Frühjahr oder Herbst direkt ins Freiland. Ich streue die Samen auf den Boden und harke sie leicht ein. Wichtig ist, dass man den Boden nach der Aussaat feucht hält. Die Keimung dauert etwa zwei bis drei Wochen. Danach sind die Pflanzen recht pflegeleicht. Ein gelegentliches Jäten um die jungen Pflanzen herum reicht meist aus.
Management in extensiven Landwirtschaftssystemen: Rückbesinnung auf Traditionen
In der extensiven Landwirtschaft hat die Kornrade bessere Chancen. Hier werden weniger Düngemittel und Pestizide eingesetzt, was ihr entgegenkommt. Einige Bio-Bauern in meiner Gegend experimentieren damit, Kornraden gezielt in ihre Fruchtfolge einzubauen. Sie säen sie zusammen mit Getreide aus und ernten beides gemeinsam. Die Kornradensamen werden dann sorgfältig aussortiert. Es ist eine Art Rückbesinnung auf alte landwirtschaftliche Praktiken, angepasst an moderne Bedürfnisse.
Es ist positiv zu sehen, wie viele Menschen sich für den Erhalt der Kornrade einsetzen. Von großangelegten Schutzprojekten bis hin zum kleinen Wildblumenbeet im Garten – jeder Beitrag zählt. Die Kornrade mag zwar giftige Samen haben, aber sie ist auch ein wichtiger Teil unseres Naturerbes. Ihr Schutz ist nicht nur eine Frage der Biodiversität, sondern auch ein Stück Kulturgeschichte, das wir bewahren sollten.
Ökosystemdienstleistungen der Kornrade: Ein Segen für die Natur
Die Kornrade mag zwar in der Landwirtschaft einen zweifelhaften Ruf genießen, doch ihre Bedeutung für das Ökosystem ist unbestreitbar. Betrachten wir die vielfältigen Dienste, die diese bemerkenswerte Pflanze der Natur erweist.
Ein Paradies für Bestäuber
Vor einem blühenden Kornradenfeld hört man geschäftiges Summen und Brummen. Die leuchtend rosa Blüten ziehen Insekten aller Art an. Besonders Bienen und Hummeln besuchen die nektarreichen Blüten häufig. In Zeiten des Insektenschwunds ist jede blühende Pflanze wertvoll - die Kornrade trägt zur Erhaltung der Artenvielfalt bei.
Gesunder Boden dank Kornrade
Nicht nur über der Erde, auch im Boden selbst wirkt die Kornrade positiv. Ihre tiefreichenden Wurzeln lockern den Boden auf und verbessern dessen Struktur. Nach dem Absterben hinterlässt sie organisches Material, das die Bodenqualität steigert. Bei zunehmender Bodenverdichtung und -erosion ist dieser Effekt bedeutsam.
Ein Augenschmaus in der Kulturlandschaft
Der Anblick eines Feldes voller rosa blühender Kornraden erfreut viele Menschen. In der oft einförmigen Agrarlandschaft sind solche Farbtupfer eine Wohltat fürs Auge. Die Kornrade trägt zur biologischen und ästhetischen Vielfalt bei - ein Aspekt, der für den Tourismus im ländlichen Raum relevant ist.
Herausforderungen bei der Wiedereingliederung: Ein Balanceakt
Die Wiedereingliederung der Kornrade in unsere Kulturlandschaft erfordert Sorgfalt. Es gilt, verschiedene Interessen zu vereinen und potenzielle Risiken zu minimieren.
Naturschutz vs. Landwirtschaft: Ein Spagat
Die größte Herausforderung besteht darin, die Interessen des Naturschutzes mit denen der Landwirtschaft zu vereinbaren. Einerseits soll die Artenvielfalt gefördert werden, andererseits darf die Ernte nicht gefährdet werden. Eine mögliche Lösung sind Blühstreifen am Feldrand, wo die Kornrade wachsen kann, ohne mit den Kulturpflanzen zu konkurrieren.
Die Sache mit der Giftigkeit
Ein heikles Thema ist die Toxizität der Kornradensamen. Früher führte die Verunreinigung von Getreide mit Kornradensamen zu gesundheitlichen Problemen. Heute gibt es effektive Reinigungsmethoden, trotzdem bleibt ein gewisses Restrisiko. Eine sorgfältige Planung und Überwachung des Anbaus ist daher wichtig.
Aufklärung tut not
Viele Landwirte und Verbraucher sehen in der Kornrade nach wie vor nur ein lästiges Unkraut. Hier ist Aufklärungsarbeit nötig. Durch gezielte Information über die ökologische Bedeutung der Pflanze können Vorurteile abgebaut und die Akzeptanz für Schutzmaßnahmen erhöht werden. Exkursionen zu Blühstreifen für Schulklassen können Verständnis schaffen.
Forschung und Zukunftsperspektiven: Neue Wege für die Kornrade
Die Wissenschaft hat die Kornrade wiederentdeckt. Aktuelle Studien liefern interessante Erkenntnisse und eröffnen neue Perspektiven für die Nutzung dieser alten Kulturbegleiterin.
Untersuchungen zur Kornrade
Forscher der Uni Göttingen untersuchen derzeit, wie sich die Kornrade auf die Insektenpopulationen in Agrarlandschaften auswirkt. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Pflanze die Artenvielfalt und Anzahl von Bestäubern erhöht. Auch die komplexen Wechselwirkungen zwischen Kornrade und Bodenmikroorganismen werden aktuell untersucht.
Auf dem Weg zur harmlosen Kornrade?
Ein vielversprechender Forschungsansatz zielt darauf ab, weniger toxische Varietäten der Kornrade zu entwickeln. Durch gezielte Züchtung versuchen Wissenschaftler, den Gehalt an giftigen Inhaltsstoffen zu reduzieren, ohne die ökologisch wertvollen Eigenschaften der Pflanze zu beeinträchtigen.
Ökolandbau als Chance
In der ökologischen Landwirtschaft könnte die Kornrade eine Renaissance erleben. Hier, wo auf chemische Unkrautbekämpfung verzichtet wird, kann sie ihre positiven Eigenschaften voll entfalten. Einige Bio-Betriebe experimentieren bereits mit dem gezielten Anbau von Kornraden in Mischkulturen. Die Pflanze dient dabei als Bienenweide und natürlicher Bodendecker, der unerwünschte Beikräuter unterdrückt.
Die Zukunft der Kornrade liegt in unserer Hand. Mit dem richtigen Ansatz können wir diese bemerkenswerte Pflanze wieder zu einem festen Bestandteil unserer Kulturlandschaft machen - zum Wohle von Mensch und Natur. Die Rolle der Kornrade in den Agrarökosystemen von morgen bleibt ein spannendes Thema.
Die Kornrade als Biodiversitätsbarometer
Die Kornrade ist nicht nur eine hübsche Blume, sondern auch ein wichtiger Indikator für die Artenvielfalt in unseren Agrarlandschaften. Als Zeigerpflanze für extensive Landwirtschaft gibt sie uns wertvolle Hinweise auf den Zustand unserer Äcker und Felder.
Extensiver Ackerbau im Fokus
Wo Kornraden wachsen, da stimmt was. Ihr Vorkommen deutet auf eine schonende Bewirtschaftung hin, bei der weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Das schafft Lebensraum für viele andere Wildkräuter und Insekten. Wo die Kornrade blüht, gedeiht auch die Vielfalt.
Agrarökosysteme unter der Lupe
Für Ökologen ist die Kornrade ein interessantes Studienobjekt. Ihre An- oder Abwesenheit verrät viel über die Qualität eines Agrarökosystems. In Untersuchungen zur Biodiversität auf Ackerflächen spielt sie eine wichtige Rolle. Ein Blick auf einen Acker kann oft schon Aufschluss über die Artenvielfalt geben.
Zukunftsperspektive: Biodiversitätsmonitoring
Könnte die Kornrade künftig als Indikator für Artenvielfalt dienen? Einige Forscher sehen darin Potenzial. Die Idee: Durch regelmäßige Erfassung der Kornradenpopulationen ließe sich die Entwicklung der Biodiversität in Agrarlandschaften langfristig beobachten. Ein praktischer, kostengünstiger und aussagekräftiger Ansatz.
Mehr als nur ein Unkraut - Die Kornrade in Kultur und Gesellschaft
Die Kornrade hat nicht nur ökologische Bedeutung. Sie hat auch in unserer Kultur Spuren hinterlassen - von der Kunst bis zum Volksglauben.
Pinsel und Feder - Die Kornrade in der Kunst
Die zarten violetten Blüten haben Künstler seit jeher inspiriert. In der Malerei erscheint die Kornrade oft als Symbol für die Schönheit der Natur. Auch in der Literatur fand sie ihren Platz. Der Dichter Rainer Maria Rilke widmete ihr ein Gedicht: 'Wie eine Krone aus violettem Licht steht sie im Korne'.
Volkstümliche Weisheiten
Im Volksglauben spielte die Kornrade einst eine wichtige Rolle. Man sagte ihr nach, sie könne böse Geister vertreiben. In manchen Gegenden wurde sie deshalb in Kränzen über die Haustür gehängt. Andere glaubten, wer eine Kornrade pflücke, dem würde bald die große Liebe begegnen. Ob's stimmt? Die Zeit wird es zeigen.
Lernen von der Natur
Heute bietet die Kornrade eine gute Möglichkeit, um Kindern und Erwachsenen die Natur näherzubringen. In Schulprojekten oder bei Naturführungen lässt sich anhand dieser Pflanze erklären, wie Ökosysteme funktionieren und warum Artenvielfalt wichtig ist. Das macht die Kornrade zu einer Botschafterin für den Naturschutz.
Ein Blick in die Zukunft der Kornrade
Die Geschichte der Kornrade ist wechselhaft. Einst weit verbreitet, dann fast verschwunden und nun langsam auf dem Weg zurück. Was können wir daraus für die Zukunft lernen?
Schutzmaßnahmen mit Weitblick
Um die Kornrade langfristig zu erhalten, braucht es durchdachte Schutzkonzepte. Das umfasst die Anlage von Blühstreifen und die Förderung extensiver Landwirtschaft. Wichtig ist auch, Landwirte für das Thema zu sensibilisieren und zu zeigen, dass Naturschutz und Landwirtschaft vereinbar sind.
Gemeinsam für mehr Vielfalt
Der Schutz der Kornrade ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Jeder kann etwas dazu beitragen - sei es durch naturnahe Gartengestaltung oder den Kauf regionaler Bioprodukte. Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jede Art wertvoll ist und ihren Platz in unserem Ökosystem hat.
Die Kornrade - Ein Symbol der Hoffnung
Die Rückkehr der Kornrade zeigt uns, dass Artenschutz wirken kann. Sie ist ein Beispiel dafür, dass wir den Verlust der Artenvielfalt aufhalten können, wenn wir uns dafür einsetzen. In diesem Sinne ist jede blühende Kornrade ein Zeichen der Hoffnung - für eine Zukunft, in der Mensch und Natur im Einklang leben.