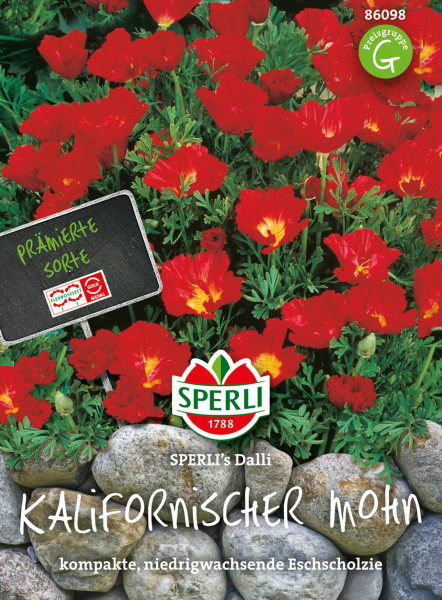Altaischer Mohn: Farbenpracht aus Zentralasien
Der Altaische Mohn verzaubert Gärten mit seinen leuchtend orangefarbenen Blüten. Diese robuste Pflanze aus den Bergregionen Zentralasiens ist ein wahrer Hingucker.
Wissenswertes für Hobbygärtner
- Winterharte Staude aus Zentralasien
- Bevorzugt sonnige Standorte
- Gedeiht in durchlässigen Böden
- Aussaat direkt ins Freiland möglich
- Pflegeleicht, aber aufmerksam gießen
Einführung zum Altaischen Mohn
Botanische Einordnung und Herkunft
Der Altaische Mohn, botanisch als Papaver pseudocanescens bekannt, gehört zur Familie der Mohngewächse (Papaveraceae). Seine Heimat sind die kargen Bergregionen Zentralasiens, insbesondere das Altai-Gebirge, dem er seinen Namen verdankt. In diesen rauen Höhenlagen hat er sich über Jahrtausende an extreme Bedingungen angepasst.
Charakteristische Merkmale
Was den Altaischen Mohn so besonders macht, sind seine auffälligen Blüten. Sie leuchten in einem intensiven Orange und können einen Durchmesser von bis zu 10 cm erreichen. Die Blütenblätter haben oft eine seidige Textur, was ihnen einen besonderen Glanz verleiht. Die Pflanze selbst bleibt mit einer Höhe von 20 bis 40 cm relativ kompakt. Ihre grau-grünen, fein behaarten Blätter bilden einen schönen Kontrast zu den leuchtenden Blüten.
Ein weiteres Merkmal ist die ausgeprägte Winterhärte. Der Altaische Mohn übersteht problemlos Temperaturen bis zu -20°C, was ihn zu einer robusten Wahl für viele Gärten macht. Die Blütezeit erstreckt sich üblicherweise von Mai bis Juli, wobei einzelne Pflanzen bei günstigen Bedingungen auch länger blühen können.
Bedeutung in Garten und Landschaftsgestaltung
In der Gartengestaltung ist der Altaische Mohn ein wahrer Tausendsassa. Seine kompakte Wuchsform und die auffälligen Blüten machen ihn zu einem idealen Blickfang in Steingärten oder Alpinarien. Hier kommt seine natürliche Herkunft aus den Bergregionen besonders zur Geltung. Aber auch in Staudenbeeten oder als Vorpflanzung vor Gehölzen setzt er farbenfrohe Akzente.
Besonders gut harmoniert der Altaische Mohn mit anderen Gebirgspflanzen wie Steinbrech, Blaukissen oder Silberwurz. Seine orangefarbenen Blüten bilden einen reizvollen Kontrast zu blauen und violetten Blüten anderer Stauden. In naturnahen Gärten trägt er zur ökologischen Vielfalt bei, da seine Blüten eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten darstellen.
Landschaftsarchitekten schätzen den Altaischen Mohn für seine Trockenheitstoleranz und Pflegeleichtigkeit. In öffentlichen Anlagen oder extensiv gepflegten Bereichen kann er sich gut behaupten und sorgt für langanhaltende Farbtupfer. Auch in Dachbegrünungen findet er aufgrund seiner Anspruchslosigkeit zunehmend Verwendung.
Standortanforderungen
Lichtverhältnisse
Der Altaische Mohn ist ein echter Sonnenanbeter. Er bevorzugt vollsonnige Standorte, an denen er mindestens sechs Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag erhält. Diese Vorliebe für Sonne ist ein Erbe seiner Herkunft aus den Hochlagen Zentralasiens, wo intensive Sonneneinstrahlung an der Tagesordnung ist.
An halbschattigen Standorten kann der Altaische Mohn zwar überleben, aber seine Blühfreudigkeit lässt dann deutlich nach. Zudem werden die Pflanzen in solchen Lagen oft lang und instabil. Um die charakteristische kompakte Wuchsform und die üppige Blüte zu erhalten, sollten Sie ihm also den sonnigsten Platz in Ihrem Garten gönnen.
Bodenbeschaffenheit
Wenn es um den Boden geht, zeigt sich der Altaische Mohn von seiner anspruchslosen Seite. Er gedeiht am besten in durchlässigen, eher mageren Böden. Schwere, lehmige oder staunasse Böden sind dagegen ungeeignet und können zu Wurzelfäule führen.
Ideal ist ein sandiger bis kiesiger Boden mit einem pH-Wert im leicht alkalischen Bereich. Der Altaische Mohn verträgt auch kalkhaltige Böden gut, was ihn zu einer guten Wahl für Regionen mit hohem Kalkgehalt macht. Eine Besonderheit: Er kommt mit nährstoffarmen Böden zurecht und benötigt keine zusätzliche Düngung. Zu nährstoffreiche Böden können sogar zu übermäßigem Wachstum auf Kosten der Blütenbildung führen.
Klimatische Bedingungen
Die Robustheit des Altaischen Mohns zeigt sich besonders in seiner Anpassungsfähigkeit an verschiedene klimatische Bedingungen. Er ist winterhart bis etwa -20°C und übersteht problemlos auch kalte Winter in Mitteleuropa. Im Sommer verträgt er Hitze und Trockenheit erstaunlich gut, was ihn zu einer zukunftssicheren Pflanze im Zeichen des Klimawandels macht.
Allerdings sollten Sie beachten, dass der Altaische Mohn empfindlich auf Staunässe reagiert, besonders im Winter. Gute Drainage ist daher essenziell. In Regionen mit sehr hohen Niederschlagsmengen empfiehlt es sich, den Boden mit Kies oder Splitt aufzulockern, um überschüssiges Wasser schnell abzuleiten.
Wind stellt für den Altaischen Mohn in der Regel kein Problem dar. Seine kompakte Wuchsform und die Anpassung an raue Bergregionen machen ihn widerstandsfähig gegen Windeinflüsse. Dies macht ihn auch zu einer guten Wahl für exponierte Gartenbereiche oder Dachgärten.
Vorbereitung zur Aussaat
Wahl des richtigen Zeitpunkts
Der optimale Zeitpunkt für die Aussaat des Altaischen Mohns hängt davon ab, ob Sie eine Frühjahrs- oder Herbstaussaat bevorzugen. Bei der Frühjahrsaussaat sollten Sie die Samen ab Mitte April bis Ende Mai direkt ins Freiland säen. Achten Sie darauf, dass keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind.
Eine Alternative ist die Herbstaussaat von September bis Oktober. Diese Methode ahmt den natürlichen Aussaatzyklus nach und kann zu kräftigeren Pflanzen führen. Die Samen überwintern im Boden und keimen im folgenden Frühjahr. Bedenken Sie jedoch, dass bei der Herbstaussaat ein gewisser Teil der Samen durch Witterungseinflüsse oder Tierfraß verloren gehen kann.
Bodenvorbereitung
Eine gründliche Bodenvorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Aussaat des Altaischen Mohns. Beginnen Sie damit, den Boden etwa 20-30 cm tief zu lockern. Entfernen Sie dabei Steine, Wurzelreste und Unkräuter. Wenn Ihr Boden zu schwer oder lehmig ist, mischen Sie Sand oder feinen Kies unter, um die Drainage zu verbessern.
Verzichten Sie auf das Einarbeiten von frischem Kompost oder stickstoffreichem Dünger. Der Altaische Mohn bevorzugt magere Böden, und zu viele Nährstoffe können zu üppigem Blattwachstum auf Kosten der Blütenbildung führen. Ist Ihr Boden sehr sauer, können Sie etwas Kalk einarbeiten, um den pH-Wert leicht anzuheben.
Planieren Sie die Oberfläche anschließend mit einem Rechen. Eine ebene, fein krümelige Oberfläche erleichtert die gleichmäßige Aussaat und das spätere Keimen der feinen Mohnsamen.
Benötigte Materialien und Werkzeuge
Für eine erfolgreiche Aussaat des Altaischen Mohns benötigen Sie folgende Materialien und Werkzeuge:
- Saatgut des Altaischen Mohns
- Spaten oder Grabegabel zum Lockern des Bodens
- Rechen zum Einebnen der Fläche
- Feiner Sand zum Strecken des Saatguts
- Gießkanne mit feiner Brause
- Eventuell Vlies oder Reisig zum Schutz vor Vögeln
- Markierungsstäbe oder -schnüre zur Kennzeichnung der Aussaatfläche
- Optional: feinmaschiges Sieb zum gleichmäßigen Verteilen der Samen
Mit diesen Vorbereitungen und Materialien sind Sie bestens gerüstet, um Ihren Garten mit der faszinierenden Schönheit des Altaischen Mohns zu bereichern. Denken Sie daran, dass Geduld gefragt ist - die Keimung kann je nach Bedingungen einige Wochen dauern. Aber die Belohnung in Form der prachtvollen orangefarbenen Blüten ist die Wartezeit definitiv wert.
Aussaatmethoden für den Altaischen Mohn
Der Altaische Mohn lässt sich auf verschiedene Arten aussäen. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile, die wir nun genauer betrachten.
Direktsaat ins Freiland
Die Direktsaat ist die einfachste Methode, um Altaischen Mohn anzubauen. Hier die Vorgehensweise:
- Wählen Sie einen sonnigen Standort mit durchlässigem Boden.
- Lockern Sie die Erde und entfernen Sie Unkraut.
- Säen Sie die Samen dünn aus und bedecken Sie sie leicht mit Erde.
- Halten Sie den Boden feucht, bis die Samen keimen.
Vorteile: Einfach und naturnah. Die Pflanzen entwickeln sich von Anfang an im Freiland und sind oft robuster.
Nachteile: Höheres Risiko durch Witterungseinflüsse und Schädlinge.
Vorkultur im Haus
Die Vorkultur bietet mehr Kontrolle über die Wachstumsbedingungen. So gehen Sie vor:
- Füllen Sie Anzuchttöpfe mit nährstoffarmer Aussaaterde.
- Säen Sie die Samen einzeln aus und bedecken Sie sie leicht.
- Stellen Sie die Töpfe an einen hellen, kühlen Ort (etwa 15°C).
- Nach der Keimung können Sie die Sämlinge ins Freiland umsetzen.
Vorteile: Bessere Kontrolle über Keimung und Anfangswachstum. Längere Anbausaison möglich.
Nachteile: Aufwendiger. Die Pflanzen müssen vorsichtig umgesetzt werden.
Aussaat in Töpfen oder Containern
Diese Methode eignet sich besonders für Balkone oder Terrassen:
- Wählen Sie Töpfe mit mindestens 30 cm Tiefe und guter Drainage.
- Verwenden Sie durchlässige, nährstoffarme Erde.
- Säen Sie die Samen direkt in die Töpfe und bedecken Sie sie leicht.
- Stellen Sie die Töpfe an einen sonnigen Standort.
Diese Methode kombiniert die Vorteile der Direktsaat mit der Flexibilität der Topfkultur.
Keimung und erste Wachstumsphase
Die Keimung ist eine kritische Phase im Leben des Altaischen Mohns. Hier einige Tipps für optimale Bedingungen:
Optimale Keimbedingungen
- Temperatur: Idealerweise zwischen 15-20°C
- Feuchtigkeit: Gleichmäßig feucht, aber nicht nass
- Licht: Keimung erfolgt im Dunkeln, danach heller Standort
Achten Sie darauf, dass der Boden nicht austrocknet, aber auch nicht zu feucht wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Dauer bis zum Auflaufen
In der Regel keimen die Samen des Altaischen Mohns innerhalb von 10-20 Tagen. Bei optimalen Bedingungen kann es auch schneller gehen. Geduld ist hier gefragt - manchmal brauchen die Samen etwas länger.
Pflege der Keimlinge
Sobald die ersten Blättchen erscheinen, benötigen die Keimlinge besondere Aufmerksamkeit:
- Stellen Sie sie an einen hellen, aber nicht zu sonnigen Ort.
- Gießen Sie vorsichtig, am besten von unten.
- Entfernen Sie schwache oder kranke Sämlinge.
- Bei Vorkultur im Haus: Gewöhnen Sie die Pflanzen langsam ans Freiland.
Auspflanzen und Etablierung
Der richtige Zeitpunkt und die richtige Technik beim Auspflanzen sind entscheidend für den Erfolg Ihrer Altaischen Mohn-Kultur.
Richtiger Zeitpunkt zum Auspflanzen
Setzen Sie vorkultivierte Pflanzen ins Freiland, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind - in der Regel ab Mitte Mai. Die Pflanzen sollten etwa 10-15 cm hoch sein und mehrere echte Blätter haben.
Pflanzabstand und -tiefe
- Pflanzabstand: 30-40 cm zwischen den Pflanzen
- Reihenabstand: 40-50 cm
- Pflanztiefe: So tief einsetzen, dass der Wurzelballen bedeckt ist
Ein großzügiger Abstand fördert die Luftzirkulation und reduziert das Risiko von Pilzkrankheiten.
Eingewöhnungsphase und erste Pflege
Nach dem Auspflanzen brauchen die jungen Mohnpflanzen besondere Aufmerksamkeit:
- Gießen Sie regelmäßig, aber nicht zu viel.
- Schützen Sie die Pflanzen in den ersten Tagen vor starker Sonne.
- Entfernen Sie Unkraut vorsichtig, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.
- Beobachten Sie die Pflanzen auf Anzeichen von Stress oder Krankheiten.
Mit der richtigen Pflege in dieser Phase legen Sie den Grundstein für kräftige, blühfreudige Pflanzen. Denken Sie daran: Der Altaische Mohn mag es eher trocken. Zu viel Feuchtigkeit kann zu Wurzelfäule führen.
Mit diesen Tipps zur Aussaat, Keimung und Auspflanzung haben Sie die besten Voraussetzungen geschaffen, um sich an der Pracht des Altaischen Mohns in Ihrem Garten zu erfreuen. Im nächsten Abschnitt werden wir uns der laufenden Pflege widmen, die Ihre Pflanzen zu voller Blüte bringt.
Laufende Pflege des Altaischen Mohns
Bewässerung: Der Schlüssel zum Erfolg
Der Altaische Mohn ist zwar recht genügsam, aber für ein prächtiges Wachstum braucht er dennoch die richtige Menge Wasser. Zu viel davon ist allerdings genauso schädlich wie zu wenig.
Wasserbedarf
In der Regel kommt der Altaische Mohn mit der natürlichen Niederschlagsmenge gut zurecht. Nur bei längeren Trockenperioden sollten Sie nachhelfen. Ein guter Indikator ist der Boden: Fühlt er sich in den oberen 5 cm trocken an, ist es Zeit zum Gießen.
Bewässerungstechniken
Am besten gießen Sie morgens oder abends direkt an der Wurzel. Vermeiden Sie Overhead-Bewässerung, da nasse Blätter anfälliger für Pilzkrankheiten sind. Ein Trick aus meinem Garten: Ich nutze eine Mulchschicht aus Stroh oder Rindenmulch, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten.
Düngung: Weniger ist mehr
Der Altaische Mohn ist kein Nährstoff-Fresser. Zu viel Dünger kann sogar kontraproduktiv sein und zu übermäßigem Blattwachstum auf Kosten der Blüten führen.
Nährstoffbedarf
Ein leicht kalkhaltiger, nährstoffarmer Boden ist ideal. Zu viel Stickstoff führt zu weichem Gewebe, das anfälliger für Krankheiten und Schädlinge ist.
Düngemethoden und -zeitpunkte
Wenn überhaupt, düngen Sie nur im Frühjahr mit einer kleinen Menge Kompost oder einem organischen Langzeitdünger. In meinem Garten habe ich gute Erfahrungen mit einer dünnen Schicht gut verrottetem Pferdemist gemacht.
Bodenbearbeitung und Unkrautbekämpfung
Der Altaische Mohn mag's locker um die Wurzeln. Regelmäßiges, vorsichtiges Lockern des Bodens fördert die Durchlüftung und verhindert Staunässe. Beim Jäten sollten Sie behutsam vorgehen, da die Wurzeln recht empfindlich sind.
Ein Tipp aus der Praxis: Ich nutze eine Mulchschicht nicht nur zur Feuchtigkeitsregulierung, sondern auch zur Unkrautunterdrückung. Das spart Zeit und schont die Pflanzen.
Rückschnitt und Formgebung
Nach der Blüte können Sie die verwelkten Blütenstände entfernen, um die Samenbildung zu verhindern und die Pflanze zu einer zweiten Blüte anzuregen. Im Spätherbst schneiden Sie die Pflanze bodennah zurück. Das fördert im nächsten Jahr kräftiges Wachstum.
Überwinterung: So trotzt der Altaische Mohn der Kälte
Winterhärte des Altaischen Mohns
Der Altaische Mohn ist erstaunlich winterhart. In seiner Heimat, den Bergregionen Zentralasiens, trotzt er extremen Bedingungen. In unseren Breiten übersteht er problemlos Temperaturen bis -20°C.
Vorbereitungen für den Winter
Trotz seiner Robustheit freut sich der Altaische Mohn über etwas Winterschutz. Nach dem Rückschnitt im Herbst decke ich die Pflanzen mit einer lockeren Schicht aus Laub oder Reisig ab. Das schützt vor Frost und verhindert, dass die Pflanzen bei Tauwetter aus dem Boden gedrückt werden.
Schutzmaßnahmen bei extremen Bedingungen
In besonders kalten Regionen oder bei angekündigtem Extremfrost können Sie zusätzlich einen Vlies über die Pflanzen legen. Achten Sie aber darauf, diesen bei milderen Temperaturen wieder zu entfernen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Ein Trick aus meinem Garten: Ich stelle manchmal Tontöpfe über besonders empfindliche Jungpflanzen. Das schafft ein günstigeres Mikroklima.
Vermehrung: So vergrößern Sie Ihren Mohn-Bestand
Samenernte und -aufbewahrung
Die Samenkapseln des Altaischen Mohns sind nicht nur dekorativ, sondern auch praktisch für die Vermehrung. Lassen Sie einige Blüten verblühen und warten Sie, bis die Kapseln braun und trocken sind. Dann können Sie die Samen ernten.
Tipp: Stülpen Sie kleine Papiertüten über reife Samenstände. So fangen Sie die Samen auf, bevor sie sich selbst aussäen.
Die geernteten Samen bewahren Sie am besten in Papiertüten an einem kühlen, trockenen Ort auf. So bleiben sie bis zur nächsten Aussaat im Frühjahr keimfähig.
Teilung etablierter Pflanzen
Alle drei bis vier Jahre können Sie größere Horste des Altaischen Mohns teilen. Der beste Zeitpunkt dafür ist das zeitige Frühjahr, kurz bevor die neuen Triebe erscheinen. Graben Sie die Pflanze vorsichtig aus und teilen Sie den Wurzelstock mit einem scharfen Spaten oder Messer. Jedes Teilstück sollte mehrere Triebknospen haben.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Die geteilten Pflanzen brauchen im ersten Jahr nach der Teilung besondere Aufmerksamkeit bei der Bewässerung.
Stecklingsvermehrung
Die Vermehrung über Stecklinge ist beim Altaischen Mohn eher unüblich, aber möglich. Im Frühsommer können Sie Triebspitzen von etwa 10 cm Länge schneiden. Entfernen Sie die unteren Blätter und stecken Sie die Stecklinge in ein sandiges Substrat. Halten Sie sie feucht und warm, bis sich Wurzeln gebildet haben.
Mein persönlicher Tipp: Ich habe die besten Ergebnisse erzielt, wenn ich die Stecklinge mit einem Bewurzelungshormon behandelt habe. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Erfolgsquote deutlich.
Mit diesen Methoden können Sie Ihren Bestand an Altaischem Mohn vergrößern und die Schönheit dieser faszinierenden Pflanze in Ihrem ganzen Garten genießen. Denken Sie daran: Jede Pflanze ist einzigartig und braucht manchmal etwas Geduld und Experimentierfreude. Aber glauben Sie mir, die Mühe lohnt sich!
Krankheiten und Schädlinge beim Altaischen Mohn
Auch wenn der Altaische Mohn als recht robust gilt, kann er von verschiedenen Krankheiten und Schädlingen heimgesucht werden. Ein wachsames Auge hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Häufige Krankheiten
Grauschimmel (Botrytis)
Symptome: Grau-braune, pelzige Beläge auf Blättern und Stängeln, besonders bei feuchter Witterung.
Behandlung: Befallene Pflanzenteile entfernen, für gute Luftzirkulation sorgen und Staunässe vermeiden. In hartnäckigen Fällen können biologische Fungizide helfen.
Mehltau
Symptome: Weißlicher, mehlartiger Belag auf Blättern und Stängeln.
Behandlung: Befallene Teile entfernen, Pflanze nicht von oben gießen. Eine Spritzung mit verdünnter Magermilch kann vorbeugend wirken.
Typische Schädlinge
Blattläuse
Erkennung: Kleine grüne, braune oder schwarze Insekten, die in Kolonien an Triebspitzen und Blattunterseiten saugen.
Bekämpfung: Abspritzen mit Wasser, Einsatz von Nützlingen wie Marienkäfern oder Behandlung mit Schmierseifenlösung.
Schnecken
Erkennung: Fraßspuren an Blättern und Stängeln, besonders bei jungen Pflanzen.
Bekämpfung: Schneckenzäune, Bierfallen oder umweltfreundliche Schneckenkörner. Auch das Auslegen von Vlies kann helfen.
Generell gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Ein gesunder Standort, ausgewogene Düngung und regelmäßige Pflege stärken die Widerstandskraft des Altaischen Mohns.
Kreative Verwendung im Garten
Der Altaische Mohn ist ein echter Hingucker im Garten. Seine leuchtend orangefarbenen Blüten setzen farbenfrohe Akzente und ziehen die Blicke auf sich. Hier ein paar Ideen, wie Sie ihn gekonnt in Szene setzen können:
Gestaltungsideen mit Altaischem Mohn
- Gruppenpflanzung: Setzen Sie mehrere Pflanzen in Gruppen, um eine stärkere Wirkung zu erzielen.
- Beetrand: Als Einfassung von Beeten sorgt der Altaische Mohn für einen farbenfrohen Rahmen.
- Wildblumenwiese: Integrieren Sie ihn in eine naturnahe Blumenwiese für einen natürlichen Look.
- Kübelbepflanzung: Auch in größeren Töpfen auf Terrasse oder Balkon macht sich der Mohn gut.
Harmonische Pflanzenkombinationen
Der Altaische Mohn lässt sich wunderbar mit anderen Stauden und Gräsern kombinieren:
- Blaue Akzente: Rittersporn oder Katzenminze bilden einen schönen Kontrast.
- Ton-in-Ton: Taglilien oder Fackellilien in Gelb- oder Orangetönen für harmonische Farbübergänge.
- Gräser: Federgras oder Lampenputzergras für eine natürliche Optik.
- Bodendecker: Storchschnabel oder Polsterphlox als Unterpflanzung.
Steingarten und Alpinum
Der Altaische Mohn fühlt sich in Steingärten und Alpinum besonders wohl. Seine Herkunft aus den Bergregionen Zentralasiens macht ihn zum idealen Kandidaten für diese Bereiche:
- Platzieren Sie ihn zwischen Steinen und Felsen für einen naturnahen Look.
- Kombinieren Sie ihn mit anderen alpinen Pflanzen wie Steinbrech, Blaukissen oder Silberwurz.
- Nutzen Sie sein Trockenheits-Toleranz in kiesigen oder sandigen Bereichen des Gartens.
Denken Sie daran: Der Altaische Mohn mag es sonnig und gut drainiert. Achten Sie darauf, dass er nicht zu feucht steht, besonders in Steingärten und Alpinum.
Den Altaischen Mohn erfolgreich kultivieren
Zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Punkte für eine erfolgreiche Kultur des Altaischen Mohns:
- Standort: Sonnig bis halbschattig, gut drainierter Boden.
- Aussaat: Direktsaat ins Freiland ab Mai oder Vorkultur im Haus.
- Pflege: Mäßig gießen, sparsam düngen, Rückschnitt nach der Blüte.
- Winterschutz: In rauen Lagen leichte Abdeckung mit Reisig.
- Vermehrung: Durch Aussaat oder Teilung etablierter Pflanzen.
Mit diesen Tipps steht einer prachtvollen Blüte des Altaischen Mohns in Ihrem Garten nichts mehr im Wege. Genießen Sie die leuchtenden Farben und die filigrane Schönheit dieser faszinierenden Pflanze. Und wer weiß - vielleicht entdecken Sie ja noch den einen oder anderen Trick, um Ihren Altaischen Mohn zum absoluten Garten-Star zu machen. Gärtnern ist eben immer auch ein bisschen Experimentieren und Lernen. In diesem Sinne: Viel Freude mit Ihrem Altaischen Mohn!