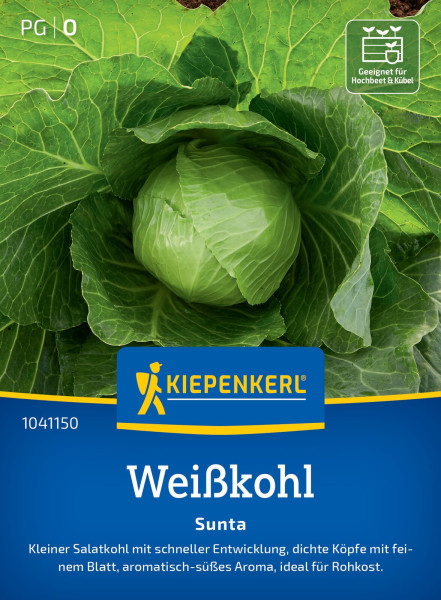Weißkohl: Der vielseitige Star im Gemüsegarten
Wer hätte gedacht, dass Weißkohl so faszinierend sein kann? Dieses robuste und ertragreiche Gemüse verdient wirklich einen Platz in jedem Garten. Seine Vielseitigkeit in der Küche und die relativ einfache Pflege machen ihn zu einem echten Favoriten unter uns Hobbygärtnern.
Weißkohl im Jahresverlauf: Ein kurzer Überblick
- Frühling: Hier geht's los mit Aussaat und Beetvorbereitung
- Sommer: Die Hauptwachstumsphase - jetzt heißt es pflegen und beobachten
- Herbst: Erntezeit und Bodennachbereitung
- Winter: Zeit für optimale Lagerung und Planung der nächsten Saison
Warum Weißkohl im Gemüsegarten nicht fehlen sollte
Weißkohl, den manche auch als Weißkraut kennen, ist wirklich ein Multitalent im Garten. In meiner langjährigen Gärtnererfahrung bin ich immer wieder erstaunt, wie anpassungsfähig diese Pflanze ist. Als Kohlgewächs liefert er nicht nur eine reiche Ernte, sondern verbessert durch seine tiefgehenden Wurzeln auch die Bodenstruktur. Ein weiterer Pluspunkt: Weißkohl steckt voller Vitamine und Ballaststoffe, was ihn zu einem wertvollen Beitrag für eine gesunde Ernährung macht.
Ein Blick auf die Jahreszeiten-Anforderungen
Der Anbau von Weißkohl erstreckt sich über fast das gesamte Jahr, und jede Jahreszeit bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich:
- Frühling: Jetzt ist die Zeit für die Aussaat und Vorbereitung des Beetes
- Sommer: Die Hauptwachstumsphase erfordert regelmäßige Pflege und ausreichend Wasser
- Herbst: Erntezeit und Vorbereitung des Bodens für die nächste Saison
- Winter: Nun geht es um die richtige Lagerung der Ernte und die Planung fürs kommende Jahr
Frühlingserwachen: Vorbereitung und Aussaat
Den Boden fit machen
Ein gut vorbereiteter Boden ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Weißkohlernte. Sobald der Boden im Frühling abgetrocknet ist, beginne ich mit der Bodenbearbeitung. Weißkohl mag es nährstoffreich und tiefgründig. Ich lockere die Erde gründlich auf und arbeite gut verrotteten Kompost ein. Ein pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0 scheint ideal zu sein - falls nötig, kalke ich den Boden leicht.
Aussaat: Freiland oder Vorkultur?
Je nach Sorte und Klimazone kann die Aussaat ab März starten. Für eine frühe Ernte ziehe ich die Pflanzen gerne in Töpfen vor. Die Samen kommen etwa 1-2 cm tief in die Erde. Bei der Direktsaat im Freiland warte ich lieber, bis keine Fröste mehr zu erwarten sind - meist ab Mitte April. Ich halte einen Reihenabstand von etwa 60-70 cm ein und lasse in der Reihe 40-50 cm zwischen den Pflanzen.
Die Jungpflanzen hegen und pflegen
In den ersten Wochen brauchen die jungen Weißkohlpflanzen besondere Aufmerksamkeit. Der Boden sollte gleichmäßig feucht sein, und Schutz vor Schnecken ist ein Muss. Ein Schneckenkragen aus Kunststoff oder eine Schicht aus Sägespänen um die Pflanzen herum hat sich bei mir bewährt. Sobald die Pflanzen kräftig genug erscheinen, vereinzele ich sie auf den endgültigen Abstand.
Sommerzeit: Die Hauptwachstumsphase
Setzlinge ins Freiland bringen
Wenn die vorgezogenen Pflanzen etwa 10-15 cm groß sind und 4-6 Blätter haben, ist es Zeit fürs Freiland. Ich setze sie etwas tiefer als sie im Topf standen - das fördert die Bildung zusätzlicher Wurzeln. Ein bewölkter Tag oder der Abend sind ideal zum Pflanzen, das reduziert den Stress für die Jungpflanzen.
Wasser und Nährstoffe: Die Lebensadern des Weißkohls
Weißkohl ist ziemlich durstig, besonders während der Kopfbildung. Regelmäßiges und durchdringendes Gießen ist wichtig, wobei ich darauf achte, die Blätter möglichst trocken zu halten - das beugt Pilzerkrankungen vor. Etwa 4-6 Wochen nach dem Auspflanzen gebe ich eine Nachdüngung mit einem organischen Dünger. Vorsicht ist jedoch geboten: Zu viel Stickstoff kann die Festigkeit der Köpfe beeinträchtigen.
Dem Unkraut den Garaus machen
Regelmäßiges Hacken und Jäten ist unerlässlich, um Konkurrenz durch Unkräuter zu vermeiden. Beim Hacken gehe ich vorsichtig vor, um die flachen Wurzeln des Weißkohls nicht zu beschädigen. Eine Mulchschicht aus Stroh oder Grasschnitt hat sich bei mir bewährt - sie hält den Boden feucht und unterdrückt das Unkrautwachstum.
Mit der richtigen Pflege in diesen entscheidenden Phasen legen Sie den Grundstein für eine reiche Weißkohlernte im Herbst. Beobachten Sie Ihre Pflanzen genau und passen Sie Ihre Pflege entsprechend an - jeder Garten ist ein bisschen anders, und manchmal braucht es etwas Experimentierfreude, um die perfekte Pflegeroutine zu finden.
Schädlinge und Krankheiten beim Weißkohlanbau: Ein Kampf der Geduld
Ungebetene Gäste: Kohlweißling und Kohlfliege
Wer Weißkohl anbaut, wird früher oder später mit Schädlingen Bekanntschaft machen. Der Kohlweißling ist einer dieser hartnäckigen Besucher. Seine Raupen können in kürzester Zeit ganze Blätter in Spitzendeckchen verwandeln. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Kohljahr, als ich die grünen Raupen erst bemerkte, nachdem sie schon die Hälfte meiner Pflanzen kahl gefressen hatten.
Die Kohlfliege ist ein weiterer Quälgeist, der uns Gärtnern das Leben schwer macht. Ihre Maden knabbern unbemerkt an den Wurzeln und können besonders junge Pflanzen regelrecht umhauen. Das Tückische daran: Oft merkt man den Befall erst, wenn es schon zu spät ist.
Die heimtückische Kohlhernie: Ein Albtraum für Kohlgärtner
Unter den Krankheiten ist die Kohlhernie der wahre Schrecken jedes Kohlgärtners. Sie verursacht knubbelige Wucherungen an den Wurzeln, die die Nährstoff- und Wasseraufnahme behindern. Befallene Pflanzen kümmern vor sich hin und bringen kaum etwas auf den Teller. Es ist wirklich frustrierend, wenn man monatelang gepflegt hat, nur um dann mit leeren Händen dazustehen.
Vorsorge ist die beste Medizin: Bewährte Präventionsmaßnahmen
Um Schädlingen und Krankheiten ein Schnippchen zu schlagen, gibt es einige Methoden, die sich über die Jahre bewährt haben:
- Fruchtfolge einhalten: Kohl sollte nicht öfter als alle 4 Jahre auf derselben Fläche angebaut werden. Das bricht die Vermehrungszyklen vieler Schädlinge.
- Auf Qualität setzen: Verwenden Sie nur zertifiziertes, krankheitsfreies Saatgut oder vorgezogene Jungpflanzen. Das ist zwar etwas teurer, zahlt sich aber aus.
- Sauberkeit im Beet: Kranke Pflanzen und Pflanzenreste sollten sofort entfernt und nicht auf den Kompost geworfen werden. Das verhindert die Ausbreitung von Krankheiten.
- Nützlinge willkommen heißen: Ein Blühstreifen lockt natürliche Gegenspieler wie Schlupfwespen an. Das ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch nützlich.
Biologische Schädlingsbekämpfung: Natur gegen Natur
Wenn Probleme auftauchen, gibt es einige biologische Methoden, die ich gerne anwende:
- Netze spannen: Feinmaschige Kulturschutznetze halten viele fliegende Schädlinge fern. Es sieht vielleicht nicht besonders schön aus, ist aber sehr effektiv.
- Nützlinge einsetzen: Bacillus thuringiensis gegen Raupen oder Nematoden gegen Kohlfliegen können wahre Wunder wirken.
- Pflanzenjauchen nutzen: Brennnesseljauche stärkt die Pflanzen und vertreibt manche Schädlinge. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, aber die Wirkung überzeugt.
- Klebefallen aufstellen: Gelbtafeln locken Kohlfliegen an und fangen sie ab. Es ist faszinierend zu beobachten, wie viele Insekten daran kleben bleiben.
Mit diesen Methoden habe ich in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht. Ein hundertprozentiger Schutz ist zwar nicht möglich, aber man kann den Schädlingen das Leben deutlich erschweren. Es erfordert etwas Geduld und Ausdauer, aber die Mühe lohnt sich, wenn man am Ende gesunde Kohlköpfe ernten kann.
Herbst: Die Krönung der Kohlsaison
Erntezeichen und -methoden: Der richtige Zeitpunkt ist alles
Die Erntezeit für Weißkohl beginnt je nach Sorte ab August und kann sich bis in den November ziehen. Nach monatelanger Pflege ist es immer wieder spannend zu beobachten, wie die Köpfe heranreifen. Folgende Anzeichen deuten darauf hin, dass der Kohl reif für die Ernte ist:
- Kopfgröße: Der Kopf sollte seine sortentypische Größe erreicht haben. Das variiert natürlich je nach Sorte erheblich.
- Festigkeit: Bei leichtem Druck fühlt sich der Kopf fest und kompakt an. Er sollte sich nicht mehr weich oder schwammig anfühlen.
- Blattfarbe: Die äußeren Blätter beginnen leicht zu vergilben. Das ist ein sicheres Zeichen, dass der Kohl seine volle Reife erreicht hat.
Zum Ernten schneide ich den Kopf mit einem scharfen Messer knapp über dem Boden ab. Dabei lasse ich einige Umblätter dran - sie schützen den Kohl beim Transport und der Lagerung. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schwer so ein Kohlkopf sein kann!
Nach der Ernte: So bleibt der Kohl länger frisch
Nach der Ernte beginnt die spannende Phase der Verarbeitung oder Lagerung. Hier ein paar Tipps, wie ich meinen Kohl behandle:
- Beschädigte oder verschmutzte Außenblätter entferne ich vorsichtig. Sie könnten sonst faulen und den ganzen Kopf verderben.
- Die Kohlköpfe wasche ich nicht, sondern putze sie nur bei starker Verschmutzung ab. Zu viel Feuchtigkeit fördert die Fäulnis.
- Für kurzzeitige Lagerung wickle ich die Köpfe in feuchtes Zeitungspapier ein und bewahre sie im Kühlschrank auf. So bleiben sie erstaunlich lange frisch.
- Für längere Lagerung ist eine Temperatur von 0-5°C und hohe Luftfeuchtigkeit ideal. Unter diesen Bedingungen kann sich der Kohl mehrere Monate halten.
Nach der Ernte ist vor der Ernte: Bodenvorbereitung für die nächste Saison
Kaum ist die Ernte eingebracht, beginnen schon die Vorbereitungen für die nächste Saison. Um den Boden optimal vorzubereiten, beachte ich Folgendes:
- Erntereste entfernen: Alle Pflanzenreste räume ich gründlich aus dem Beet. Das beugt Krankheiten vor und sieht einfach ordentlicher aus.
- Gründüngung ansäen: Phacelia oder Winterroggen schützen den Boden vor Auswaschung und Erosion. Zudem sieht ein blühendes Phacelia-Feld im Herbst einfach wunderschön aus.
- Bodenuntersuchung: Alle paar Jahre lasse ich den pH-Wert und Nährstoffgehalt überprüfen. Das hilft mir, gezielt zu düngen und Mangelerscheinungen vorzubeugen.
- Kalk ausbringen: Bei Bedarf kalke ich den Boden im Herbst, um den pH-Wert zu regulieren. Kohl mag es eher basisch, da muss man manchmal nachhelfen.
Eine gute Bodenpflege ist der Schlüssel für eine erfolgreiche nächste Saison. Ich erledige das immer direkt nach der Ernte - so kann ich mich im Frühjahr voll auf die neue Aussaat konzentrieren. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Mühe im Herbst im nächsten Jahr auszahlt. Der Kreislauf des Gartenjahres beginnt von Neuem, und ich freue mich schon auf die nächste Kohlsaison!
Weißkohl im Winter: Lagerung und Vorausschau
Während der Wintermonate ruht zwar der Garten, aber für uns Hobbygärtner gibt es dennoch einiges zu tun - vor allem wenn es um die Lagerung unseres Weißkohls und die Planung für die kommende Saison geht. Lasst uns einen Blick darauf werfen, wie wir das Beste aus dieser Zeit machen können.
Den Weißkohl richtig einlagern
Die richtige Lagerung ist entscheidend, wenn wir unseren Weißkohl lange genießen möchten. Hier sind ein paar Tipps, die sich bei mir bewährt haben:
- Temperatur: Am besten zwischen 0 und 4 Grad Celsius
- Luftfeuchtigkeit: Etwa 90-95% - nicht zu trocken, aber auch nicht zu feucht
- Dunkelheit: Ein lichtgeschützter Raum verhindert vorzeitiges Austreiben
- Belüftung: Gute Luftzirkulation beugt Schimmelbildung vor
Ein kühler Keller oder eine traditionelle Erdmiete eignen sich hervorragend. Vor der Einlagerung entferne ich immer lose und beschädigte Blätter. Dann wickle ich die Köpfe einzeln in Zeitungspapier und lagere sie mit dem Strunk nach oben. So bleiben sie erstaunlich lange frisch.
Winterliche Kohlgerichte
Der Winter ist die perfekte Zeit, um die Vielseitigkeit des Weißkohls in der Küche zu entdecken. Hier sind einige meiner Lieblingsrezepte:
- Klassisches Sauerkraut - ein Muss in jedem Haushalt
- Herzhafter Krautsalat - eine erfrischende Abwechslung
- Gefüllte Kohlrouladen - mein Geheimtipp für kalte Wintertage
- Deftiger Kohleintopf - wärmt von innen
- Knackiges Coleslaw - perfekt als Beilage
Es lohnt sich wirklich, mit verschiedenen Zubereitungsarten zu experimentieren. Manchmal überrascht mich der Weißkohl immer noch mit neuen Geschmackserlebnissen!
Den nächsten Anbau planen
Die ruhigen Wintertage bieten eine gute Gelegenheit, um die kommende Gartensaison zu planen. Ich nutze diese Zeit gerne, um:
- Meine Erfahrungen aus dem Vorjahr zu reflektieren - was hat gut funktioniert, was könnte ich verbessern?
- Neue Sorten für den Anbau auszuwählen - vielleicht wage ich mich an eine exotische Variante?
- Einen detaillierten Anbauplan zu erstellen - das spart später viel Zeit und Ärger
- Saatgut und Gartenzubehör zu bestellen - früh dran sein lohnt sich
- Bodenproben durchzuführen - so weiß ich genau, was mein Garten braucht
Besonders wichtig ist mir dabei die Fruchtfolge. Weißkohl sollte nicht direkt nach anderen Kohlarten angebaut werden, das habe ich schon schmerzlich lernen müssen.
Weißkohlsorten und Anbaumethoden: Was passt zu Ihrem Garten?
Die Wahl der richtigen Sorte und Anbaumethode kann über Erfolg oder Misserfolg beim Weißkohlanbau entscheiden. Lassen Sie uns einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten werfen.
Von früh bis spät - die Vielfalt der Weißkohlsorten
Weißkohl ist nicht gleich Weißkohl. Je nach Reifezeit unterscheiden wir:
- Frühsorten: Diese können schon ab Juni geerntet werden. Sie bilden kleinere Köpfe mit zartem Blattgewebe - perfekt für frische Sommersalate.
- Mittlere Sorten: Ab August erntereif und vielseitig verwendbar. Meine persönlichen Favoriten für die alltägliche Küche.
- Spätsorten: Diese Kraftpakete ernten wir ab Oktober. Sie bilden große, feste Köpfe und eignen sich hervorragend zur Lagerung.
Um über eine längere Zeit frischen Kohl genießen zu können, baue ich immer verschiedene Sorten an. Das verlängert die Erntezeit enorm.
Anbaumethoden - jeder Garten ist anders
Es gibt verschiedene Wege, Weißkohl anzubauen. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile:
- Direktsaat: Einfach, aber die Jungpflanzen sind anfälliger für Schädlinge. In milden Regionen eine gute Option.
- Vorkultur und Auspflanzen: Mehr Kontrolle und besserer Schutz für die Jungpflanzen, aber auch arbeitsintensiver. Meine bevorzugte Methode, besonders bei Schneckenproblemen.
- Dammkultur: Bietet gute Drainage, erfordert aber mehr Bewässerung. In regenreichen Gebieten oft die beste Wahl.
- Flachkultur: Einfach zu bewässern, aber Vorsicht bei Staunässe. Auf leichten Böden eine gute Option.
Ich persönlich schwöre auf die Vorkultur mit anschließendem Auspflanzen. Das gibt mir mehr Kontrolle über die empfindlichen Jungpflanzen.
Mischkultur und Fruchtfolge - der Schlüssel zum Erfolg
Weißkohl ist ein geselliger Geselle im Garten. Mit den richtigen Nachbarn gedeiht er besonders gut:
- Gute Nachbarn: Zwiebeln, Sellerie und Salat harmonieren prächtig mit Weißkohl.
- Schlechte Nachbarn: Andere Kohlarten und Tomaten sollten Sie besser fernhalten.
Bei der Fruchtfolge ist zu beachten, dass Weißkohl ein echter Nährstoffzehrer ist. Ich lasse ihm gerne Schwachzehrer wie Salat oder Kräuter folgen. Außerdem halte ich eine dreijährige Anbaupause für Kohlgewächse auf derselben Fläche ein. Das beugt Krankheiten vor und hält den Boden gesund.
Mit diesen Informationen zur Sortenwahl und Anbaumethode können Sie Ihre Weißkohlernte optimieren. Scheuen Sie sich nicht, verschiedene Methoden auszuprobieren. Jeder Garten ist einzigartig, und oft findet man die besten Lösungen durch eigene Erfahrungen. Viel Erfolg und Freude bei Ihrem Weißkohlanbau!
Nährstoffbedarf und Düngung von Weißkohl: Ein Balanceakt
Weißkohl ist ein echter Nährstoff-Gourmet und braucht für sein optimales Wachstum eine ausgewogene Versorgung. Stickstoff, Phosphor und Kalium sind dabei die Hauptakteure in diesem Nährstoffdrama.
Das Dreigestirn der Hauptnährstoffe
Stickstoff ist sozusagen der Blattmacher - er sorgt für üppiges Grün und kräftige Köpfe. Phosphor kümmert sich um die Wurzeln und hält die Energieversorgung am Laufen. Kalium spielt den Bodyguard und macht die Pflanze widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Nicht zu vergessen sind Magnesium für ein sattes Grün und Calcium für stabile Zellwände. Auch Spurenelemente wie Bor und Mangan spielen ihre Rolle in diesem Nährstoffkonzert.
Organisch vs. Mineralisch: Die Qual der Wahl
Bei der Düngung stehen wir vor der Entscheidung: organisch oder mineralisch? Beide haben ihre Vor- und Nachteile:
- Organische Düngung: Kompost und Co. sind wie eine Slow-Food-Bewegung für den Boden. Sie verbessern die Bodenstruktur und füttern die Mikroorganismen mit. Allerdings braucht man etwas Geduld, bis die Nährstoffe verfügbar sind.
- Mineralische Düngung: Das ist quasi Fast Food für die Pflanzen - schnell verfügbar, aber nicht unbedingt nachhaltig. Bei übermäßigem Gebrauch kann's dem Bodenleben auf den Magen schlagen.
In meinem Garten setze ich auf eine Kombination: eine Grundlage aus Kompost, ergänzt durch gezielte mineralische Gaben. So bekommt der Kohl, was er braucht, und der Boden bleibt gesund.
Timing ist alles: Wann und wie viel düngen?
Die Düngung beginnt schon vor der Pflanzung. Etwa 4-6 Wochen vorher arbeite ich gut verrotteten Kompost in den Boden ein - pro Quadratmeter etwa 3-5 Liter. Das ist wie ein Willkommensgruß für die Jungpflanzen.
Nach dem Anwachsen gibt's die erste Kopfdüngung, gefolgt von einer zweiten Runde 4-6 Wochen später. Hier kommen organische Dünger oder spezielle Gemüsedünger zum Einsatz. Die Menge hängt von der Sorte und dem Boden ab, aber 50-80 g/m² pro Düngung sind meist eine gute Richtschnur.
Vorsicht ist jedoch geboten: Zu viel Stickstoff und der Kohl wird locker im Kopf und anfälliger für Krankheiten. Ich beobachte immer die Blattfarbe: Hellgrün schreit nach Stickstoff, während dunkelgrün mit einem Hauch von Blau signalisiert, dass alles im grünen Bereich ist.
Tipps für eine erfolgreiche Weißkohlernte: Aus Fehlern lernt man
Häufige Stolpersteine und wie man sie umgeht
Im Laufe der Jahre habe ich so einige Fehler gemacht - hier die wichtigsten Learnings:
- Platznot: Weißkohl braucht Ellbogenfreiheit. 50-60 cm zwischen den Pflanzen und 60-70 cm zwischen den Reihen sind kein Luxus, sondern Notwendigkeit.
- Wasserstress: Gleichmäßige Feuchtigkeit ist das A und O. Starke Schwankungen und der Kohl platzt buchstäblich vor Wut.
- Monokultur-Falle: Kohlgewächse sollten höchstens alle 3-4 Jahre auf dieselbe Fläche. Sonst gibt's ein Festmahl für Schädlinge und Krankheiten.
- Erntezeitpunkt verpassen: Zu spät geerntet und der Geschmack leidet. Ich ernte, sobald die Köpfe fest sind - lieber etwas früher als zu spät.
So kitzeln Sie mehr Ertrag heraus
Mit ein paar Tricks lässt sich der Ertrag deutlich steigern:
- Mulchen: Eine Schicht Stroh oder Gras hält den Boden feucht und das Unkraut in Schach.
- Regelmäßiges Hacken: Lockert den Boden und regt das Wachstum an - wie eine Massage für die Wurzeln.
- Schutz vor ungebetenen Gästen: Kulturschutznetze halten Kohlweißlinge und Co. auf Abstand.
- Mischkultur: Zwiebeln oder Kräuter als Nachbarn können Schädlinge verwirren und den Boden besser ausnutzen.
Nachhaltig gärtnern: Gut für den Kohl, gut für die Umwelt
Nachhaltiger Anbau liegt mir besonders am Herzen. Hier meine Favoriten:
- Gründüngung: Leguminosen vor oder nach dem Kohl sind wie eine Wellnesskur für den Boden.
- Kompostwirtschaft: Eigener Kompost ist Gold wert - für den Boden und den Geldbeutel.
- Clevere Bewässerung: Tröpfchenbewässerung oder frühes Gießen spart Wasser und nervt die Nachbarn nicht mit Spritzgeräuschen.
- Nützlingsförderung: Ein Blühstreifen lockt die natürlichen Verbündeten an - und sieht noch dazu hübsch aus.
Weißkohl: Ein Gemüse für alle Jahreszeiten und Lebenslagen
Die Kultivierung von Weißkohl ist wie eine Reise durch die Jahreszeiten. Im Frühling beginnt alles mit der Aussaat, der Sommer steht im Zeichen der Pflege, und im Herbst kommt endlich die Belohnung in Form knackiger Kohlköpfe.
Ich finde, Weißkohl ist ein dankbares Gemüse für uns Hobbygärtner. Mit etwas Aufmerksamkeit und der richtigen Pflege kann man sich über eine reiche Ernte freuen. Und die Vielseitigkeit in der Küche ist einfach unschlagbar - vom knackigen Salat über deftiges Sauerkraut bis zum wärmenden Eintopf.
Wenn Sie noch nie Weißkohl angebaut haben, kann ich Sie nur ermutigen, es zu versuchen. Es braucht zwar etwas Übung und Geduld, aber die Freude über den ersten selbst gezogenen Kohlkopf ist unbezahlbar. Geben Sie Ihrem Garten die Chance, Sie mit frischem Weißkohl zu überraschen - ich verspreche Ihnen, Sie werden begeistert sein!